Neue Finanzierungsquellen - epd medien
17.01.2025 08:58
Möglichkeiten der Presseförderung

epd Die Krise des gedruckten Pressegeschäfts ist notorisch: Die Auflagen sinken, Anzeigen wandern zu den großen Plattform-Konzernen ins Internet ab, nur wenigen Medienhäusern gelingt es, ihr Geschäft erfolgreich ins Internet zu verlagern. Die Frage, wie Medienschaffende in Zukunft noch unter guten finanziellen Bedingungen arbeiten können, wird seit Jahren diskutiert. Jahrelang hofften die Zeitungsverleger auf die staatliche Zustellförderung, immer wieder wird gefordert, die Mehrwertsteuer für Presseerzeugnisse auf Null zu senken, auch ein "Medienfonds" oder strukturelle Innovationsförderung sind seit Jahren im Gespräch. Bei den großen Zeitungskongressen fehlt es nie an Politikerreden, die den Wert der Presse als Grundpfeiler einer freiheitlichen Demokratie herausstellen. Doch den schönen Worten folgen selten Taten.
Anne Webert, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) sagt: "Über Abonnements und Werbung lässt sich Presse nicht mehr finanzieren. Aber ihre Bedeutung für die Gesellschaft sinkt nicht, sondern steigt eher. Um die Demokratie zu stärken, brauchen wir eine unabhängige Presse, und dazu braucht es Geld."
Bedenken gegen Zustellförderung
Schon das letzte Kabinett von Angela Merkel (CDU) hatte im Dezember 2019 ein Haushaltsgesetz vorgelegt, das vorsah, die Zustellung von Abonnementzeitungen und Anzeigenblättern im Jahr 2020 vorübergehend mit 40 Millionen Euro zu fördern. 2021, während der Corona-Pandemie, war gar von 220 Millionen Euro für die Presseförderung die Rede, doch das Bundeswirtschaftsministerium sagte dies im April 2021 "nach intensiver Prüfung der verfassungs-, haushalts- und beihilferechtlichen Umstände" wieder ab.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Zeitungen 2022 Hilfen für die Zustellung in Aussicht gestellt, doch dann blieb unklar, welches Ministerium dafür zuständig sein sollte. Im Juli 2024 teilte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) dem epd mit, die Arbeiten an einem entsprechenden Gesetz würden nicht fortgeführt.
Förderprogramm der BKM
Medienrechtler hatten sehr früh Bedenken gegen eine Zustellförderung für Zeitungen geäußert. Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der Universität Dortmund, sagt: "Wer die Presse fördern kann, ist nicht nur eine Ressourcen-, sondern auch eine Kompetenzfrage. Der Bund darf nur tätig werden, wenn es im Schwerpunkt um wirtschaftliche oder technische Fragen geht." Das gelte grundsätzlich auch für die Presseförderung. Gehe es etwa um eine allgemeine Förderung der Zeitungszustellung oder die allgemeine Herabsetzung der Umsatzsteuer für Presseprodukte, die allen Verlagen zugutekommt, könne der Bund tätig werden.
Einen Grenzfall erkennt Gostomzyk in dem 2021 aufgelegten Förderprogramm "Strukturelle Stärkung von unabhängigem Journalismus" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Claudia Roth. Es sei "gerade noch so zulässig - oder eben gerade nicht mehr, weil hier Kompetenzen der Länder berührt sein könnten", urteilt er. Allerdings stehen für dieses Programm jährlich nur ein bis zwei Millionen Euro zur Verfügung. Doch die Journalismusförderung der BKM hatte sich bereits in der ersten Förderrunde angreifbar gemacht, als ausgerechnet zwei Projekte von Jury-Mitgliedern Geld erhielten.
Projekte sind getrennt organisiert von redaktionellen Prozessen.
In der aktuellen Förderrunde gab es Kritik daran, dass das Projekt "Wegweiser KI" der Deutschen Presse-Agentur (dpa), ein Schulungsprogramm zum redaktionellen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI), mit bis zu 240.536 Euro gefördert wird. Nach Medienberichten erhält die Nachrichtenagentur seit 2021 Zuwendungen vom Bund: Bis Ende März 2025 werden demnach insgesamt rund 2,3 Millionen Euro über vier Projekte verteilt an die dpa oder gemeinnützige dpa-Töchter fließen. Allein für die Social-Media-Kampagne "Jahr der Nachricht" ("Vertraue Nachrichten, die stimmen, statt Stimmung machen") im Jahr 2024 sei rund eine Million Euro von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezahlt worden.
Die dpa wollte sich zu den Zahlen nicht äußern, ein Sprecher versicherte jedoch: "Die Förderungen sind streng zweckgebunden und werden ausschließlich dafür verwendet, die vereinbarte Leistung zu erbringen." Projekte seien "streng getrennt organisiert von allen redaktionellen Prozessen", die Projektaktivitäten würden in einer gemeinnützigen dpa-Ausgründung gebündelt.
Gemeinnützigkeit von Journalismus
Doch staatliche Förderungen bergen das Risiko, den freien Wettbewerb nachhaltig zu stören. Die Frage erscheint berechtigt, warum nicht alle Unternehmen mit Steuergeldern gefördert werden, da doch viele Medienhäuser, vor allem kleinere in entlegenen Regionen, mit ökonomischen Verwerfungen zu kämpfen haben.
Bislang sind journalistisch-redaktionelle Inhalte nicht förderfähig, auch solche Projekte nicht, die im Kern nicht kommerziellen Zwecken dienen. Die Fraktionen der Ampel-Koalition hatten sich zu Beginn der Legislaturperiode vorgenommen, das zu ändern. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sie sich 2021 darauf verständigt, dass sie Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus schaffen wollten.
Die Gemeinnützigkeit, könnte neben gewinnorientierten und öffentlich-rechtlichen Angeboten "eine weitere Finanzierungsmöglichkeit sein", sagt die stellvertretende DJV-Vorsitzende Webert, die sich auch im Forum für gemeinnützigen Journalismus engagiert. Damit könnten zusätzliche Finanzierungsquellen wie öffentliche Zuwendungen, Stiftungsgelder oder private Spenden erschlossen und nach außen hin transparent gemacht werden. Eine solche Förderung sei staatsfern und schließe politische Einflussnahme aus, sagt Webert: "Die Überprüfung durch die Finanzbehörden bezieht sich auf wirtschaftliche Bereiche, nicht auf inhaltliche. Mehr Unabhängigkeit geht kaum." Gemeinnütziger Journalismus wäre damit anderen steuerrechtlichen Transparenzregeln unterworfen, die eine verdeckte staatliche Presseförderung ausschließen.
Im August hieß es, das Finanzministerium prüfe eine entsprechende Ergänzung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung, doch der Vorstoß scheiterte schließlich am Widerstand der Länder.
Das Luxemburger Modell
Für den Perspektivwechsel lohnt ein Blick über den Tellerrand: Luxemburg gilt vielen als Vorbild für eine nationale Presseförderung. Seit die Europäische Kommission 2021 grünes Licht für die Reform des staatlichen Beihilfesystems gab, können sich Redaktionen, die ihren Sitz in der parlamentarischen Monarchie mit rund 670.000 Einwohnern haben, um eine jährliche Beihilfe bewerben. Die jährliche "Innovationshilfe" beträgt inzwischen rund 226.000 Euro, dazu gibt es einen variablen Förderanteil von jährlich bis zu rund 34.000 Euro pro vollzeitbeschäftigtem Redakteur.
In Luxemburg kommt die unbürokratische Pressehilfe als "technologieneutraler Fördermechanismus" Print- und Online-Publikationen gleichermaßen zugute: Geförderte Medien müssen regelmäßig erscheinen und dürfen keine Nischenpublikationen sein, sich also nicht nur an eine bestimmte Gruppe von Lesern richten, wenn sie die Förderung beanspruchen wollen. Und sie müssen mindestens fünf Journalisten beschäftigen, die eine "Pressekarte" vorweisen können, den vom luxemburgischen Presserat ausgestellten Berufsausweis.
Bessere Überlebenschancen für kleine Medien
Das staatliche Fördergesetz gibt es in Luxemburg seit 1976, es galt jedoch als nicht mehr zeitgemäß. 2020 legte der damalige Medienminister Xavier Bettel einen neuen Gesetzentwurf vor. Bettel, heute Vizepremierminister, erklärte damals, es gehe darum, "die Menschen, die professionelle journalistische Arbeit leisten, in den Vordergrund zu stellen". Der neue Finanzierungsmechanismus setzt daher bei der Zahl der professionellen Journalisten an. Die Pressehilfe startete 2020 mit 10,3 Millionen Euro und soll im nächsten Haushaltsjahr auf 13 Millionen Euro angehoben werden. Geregelt werden soll das mit einem Gesetzespaket zur Verbesserung des Informationszugangs, das dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss derzeit zur Prüfung vorliegt.
Nach Angaben von Paul Peckels, Generaldirektor beim "Luxemburger Wort", profitieren die meisten Medienhäuser von der direkten Pressehilfe - mit Ausnahme von RTL und dem öffentlich-rechtlichen Radio 100.7, die anderweitig finanziert oder unterstützt werden. Laut Peckels, der auch Präsident der luxemburgischen Verlegervereinigung ALMI ist, rechnet sich das vor allem für die fünf täglich erscheinenden Kaufzeitungen, die derzeit den Markt unter sich aufteilen. Die Verleger von Tageszeitungen würden außerdem indirekt durch die subventionierte Verteilung der Tageszeitungen durch die luxemburgische Post unterstützt. Beobachter sagen, kleinere Medien hätten in Luxemburg bessere Überlebenschancen, seit die Pressehilfe erhöht wurde. Die Summen, die jedes Medienhaus erhält, sind auf der Open Data Plattform für alle öffentlich einsehbar.
Private Initiative
Der DJV würde laut einem internen Papier auch in Deutschland eine solche staatliche Medienförderung befürworten, die "alle förderrelevanten Bereiche - sowohl redaktionelle als auch operative" erfassen und "alle Möglichkeiten der Fördermechanismen - sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene - ausschöpfen" könne. Ähnlich wie beim Luxemburger Modell sei "eine Förderung denkbar, die Presseunternehmen zugutekommt, die eine bestimmte Zahl an Redaktionsstellen insbesondere in ländlichen Gebieten vorhalten". Eine solche Förderung dürfe sich "nicht ausschließlich auf Printprodukte und deren Zustellung konzentrieren."
Es gibt aber auch andere Ansätze: In Berlin startete im Sommer der Media Forward Fund (MFF), eine private Stiftungsinitiative zur Förderung des Journalismus in Österreich, Deutschland und der Schweiz (DACH). Gründungsgeschäftsführer Martin Kotynek, früher Chefredakteur des österreichischen "Standard", möchte den MFF zur ersten Adresse für journalistische Innovationsprojekte in der deutschsprachigen Region machen. "Der Journalismus, insbesondere auf lokaler Ebene, ist in einer akuten Transformationskrise", sagt er. Für eine tragfähige Finanzierung brauche "ein Medium heute eine größere Zahl an Finanzierungsquellen".
Erste Zusagen für Förderungen
Nach dem Vorbild des US-Fonds Press Forward will der MFF mithilfe von Stiftungen und Philanthropen die Nachrichtenlandschaft wiederbeleben. Bisher verfügt der Fonds über neun Millionen Euro von renommierten Stiftungen wie Schöpflin, Rudolf Augstein und Mercator, Kotynek hofft, dass insgesamt 25 Millionen Euro zusammenkommen.
Um den Fonds zu konzipieren, hat die Initiative eine Anschubfinanzierung von der BKM erhalten. Die Entscheidung, wer welche Förderung bekommt, sei durch die Struktur des MFF klar von den Geldgebern getrennt, sagt Kotynek. Der MFF wolle gemeinwohlorientierte Medien fördern, "die mit neuen Geschäftsmodellen experimentieren". Medien also, die ihre Gewinne nachweislich in Journalismus reinvestieren. Im Dezember 2024 hat der Fonds den ersten vier Projekten aus der Schweiz und Österreich Förderungen in Höhe von 300.000 bis 400.000 Euro zugesagt.
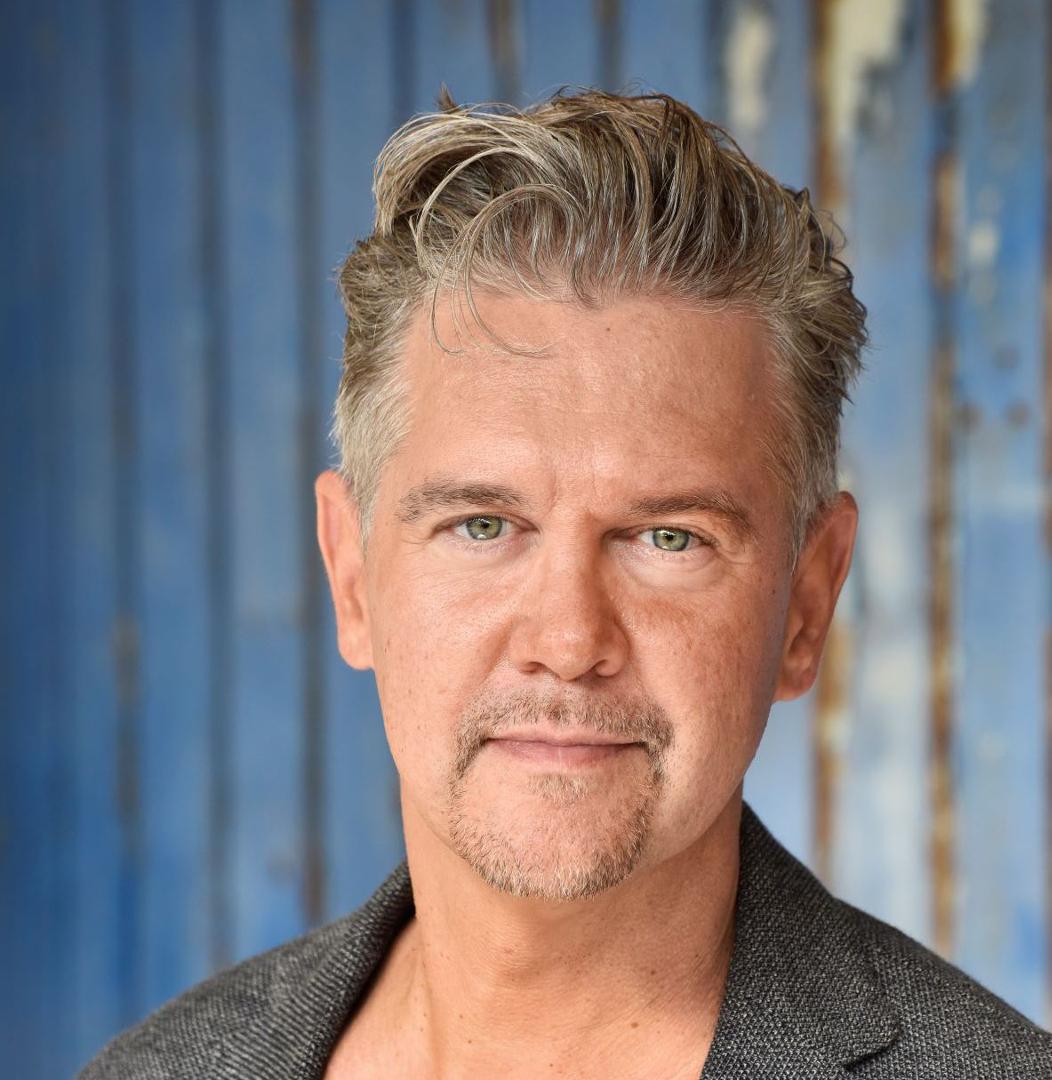 Copyright: Foto: Martin Kunze
Darstellung: Autorenbox
Text: Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler, Publizist sowie Mitgründer und Vorstand des Vocer-Instituts für Digitale Resilienz. Er sitzt im Beirat des Forums für gemeinnützigen Journalismus.
Copyright: Foto: Martin Kunze
Darstellung: Autorenbox
Text: Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler, Publizist sowie Mitgründer und Vorstand des Vocer-Instituts für Digitale Resilienz. Er sitzt im Beirat des Forums für gemeinnützigen Journalismus.
Zuerst veröffentlicht 17.01.2025 09:58 Letzte Änderung: 30.01.2025 11:17
Schlagworte: Medien, Presse, Medienpolitik, Finanzen, Förderung, Weichert, NEU
zur Startseite von epd medien