Weltliteratur lau aufgewärmt - epd medien
27.05.2025 09:48
Arte-Dokumentation "Buddenbrooks - Thomas Mann und Lübeck"
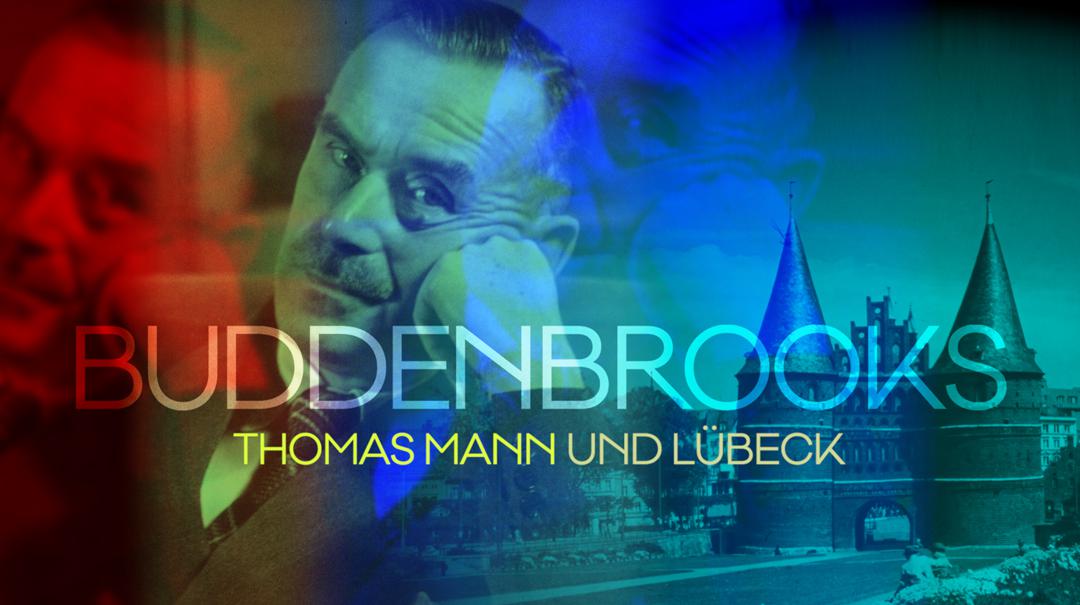
epd Vor 150 Jahren, am 6. Juni 1875, wurde der Schriftsteller Thomas Mann in Lübeck geboren. Für das Kulturfernsehen ein Glücksfall, lässt sich hier doch ein gewisser Bekanntheitsgrad mit Unterhaltung und Bildungsauftrag bestens verbinden. Entsprechend breit wird das Jubiläum gefeiert. Die gut erforschte Lebensbeschreibung des Autors bietet noch neue Aspekte, vom politischen Schriftsteller Mann lässt sich ebenfalls zehren.
Betrachtete man in Feuilletons und Kulturfernsehen früher oft mehr den Konservativen, steht jetzt, aus aktuellem Anlass der weltpolitischen Gesamtsituation, seine Verteidigung der (Weimarer) Demokratie und die BBC-Radioansprachen aus dem kalifornischen Exil, "Deutsche Hörer!", im Fokus der Berichte. Es scheint im Moment, als habe Deutschland kein Problem mit dem Mann, der die Angriffe britischer Bomber auf Lübeck 1942 als legitime Rache für Coventry rechtfertigte.
Nicht durch Tiefe langweilen
Dass Dichter mit ihren Heimatstädten Probleme haben, ja, dass sie ohne die Schwierigkeiten mit "ihrer" Stadt vielleicht gar keine Dichter geworden wären, gehört zu den Schriftsteller-Stereotypen. Manchmal sind entsprechende Untersuchungen erhellend. Diesen Anspruch hat die neue "Buddenbrooks"-Dokumentation aber eher nicht. Sie bietet "Streifzüge" durch Lübeck, geht mal hierhin, mal dorthin, grob chronologisch, sortiert entlang des Wegs manche Themen, so weit, so brav. Die Einordnung des Verhältnisses von Thomas Mann zu Lübeck unternehmen bekannte Verdächtige - ein Literaturwissenschaftler (Heinrich Detering), ein Literaturkritiker (Volker Weidermann), die unterhaltsam und kenntnisreich berichtende Leiterin des Buddenbrook-Hauses Caren Heuer oder etwa der Dramatiker John von Düffel.
Diese haben im Einzelnen viel zu sagen, die Montage (Fritz Busse und Michael Linzer) gestattet ihnen aber oft kaum, ihren Part zu Ende zu bringen, schneidet Aussagen verschiedener "Talking Heads" gar halbsatz-ergänzend wie zu einer einzigen Suada zusammen. Nicht verzögern, bloß nicht durch Tiefe langweilen.
Mann galt als "Nestbeschmutzer"
Streifzüge: Bei diesem Wort könnte man ans Flanieren, das ja eine eigene literarische Gattung hervorgebracht hat, denken. Hier ist es ein Abhaken von Orten und Themen, wie beim Suchen und Finden des nächsten Instagram-Hotspots. Beispielsweise beim Thema Schule, die Thomas Mann hasste und die er nach dreimaligem Sitzenbleiben ohne Abitur verließ. Welchen Mehrwert bringt es, das heutige Schulgebäude abzubilden, und über sein Motto "Tu es" auf Deutsch und auf Latein sinnieren zu lassen?
In der Hauptsache geht es in diesem Film um die "Buddenbrooks", die hier ausschließlich biografistisch, als Schlüsselroman gelesen werden. Die "Buddenbrooks" waren Thomas Manns erster Roman, mit 25 Jahren veröffentlicht und 1929 mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt. Dem Hauptpersonal entsprachen Mitglieder der Mannschen Familie, daneben gibt es ungefähr 400 Nebenfiguren. In Lübeck sah man nicht die Transformation der Vorlagen in Literatur, man sah sich getroffen. Mann galt als "Nestbeschmutzer" - und wurde trotzdem nach dem Zweiten Weltkrieg mit knappem Votum Ehrenbürger Lübecks. Zeitgenössische Reportage-Filmschnipsel zeigen hier Ausschnitte der Verleihung und lassen im O-Ton etwa wissen, dass Manns Frau Katia einen Blumenstrauß erhielt. So streift der Film an der Oberfläche herum und informiert höchstens Leute, die was von Berühmtheit halten.
Es liest die Thomas-Mann-KI
Damit sich der Zuschauer aber bei solcher Umschau nicht langweilt, fährt man auf, was als "State of the Art" solcher Gebrauchs-Dokumentationen gilt. Die Zeichnerin Isabel Kreitz erstellt Szenen aus den "Buddenbrooks" als Graphic Novel, während aus dem Off aus dem Roman gelesen wird. Von einer Thomas-Mann-KI-Stimme. Diese KI-Anwendung irritiert, denn sie liest zwar ähnlich, doch ohne rhetorische oder schauspielerische Begabung einen der größten Texte der Weltliteratur.
Thomas Manns Ironie und Komik, seine Sprachkunst, der Eigensinn des Textes über den Untergang eines Bürgertums, das seine Ideale des 19. Jahrhunderts dem schnöden Kaufmannssinn geopfert hat, bleibt auf der Strecke. Dass die KI Stimmimitation kann: geschenkt. Sie öffnet keinen Zugang zum Text, er bleibt reizlos. Wie viel besser wäre es gewesen, die Auszüge des Romans von einem Schauspieler gestalten zu lassen! So aber koexistieren hier Archivaufnahmen, aktuelle Bilder, Talking Heads, Graphic Novel und neben der KI-Stimme die Originalstimme Thomas Manns, die als Radioansprache eingespielt wird. Kurios. In diesem Film gibt es die Stimme des Schriftstellers zweimal - wie schizophren.
Fußnote der Literaturgeschichte
Das Kulturfernsehen-Subgenre "Der Dichter und seine Stadt" ist eigentlich höchst dankbar und keineswegs eine neue Sache. Von 1964 bis 1969 lief die entsprechend betitelte Reihe im Fernsehen, für "James Joyce und Dublin" erhielt ihr Redakteur Klaus Simon 1969 einen der ersten Grimme-Preise überhaupt. Die Filme erzählten verschränkend die Biografien von Stadt und Literat, von Werk- und Wirkungsgeschichte und fanden Gedanken visualisiert an spezifischen Orten. Natürlich muss man heute anders filmen. Es gibt nun andere visuelle Möglichkeiten, mehr telegene Expertinnen und Experten.
In "Buddenbrooks - Thomas Mann und Lübeck" werden solche Möglichkeiten zwar eingesetzt, ihr Potenzial aber wird nicht genutzt. Weil es, so scheint es, am Ende dann doch bloß um den Skandal geht, um eine Fußnote der Literaturgeschichte. Zum Jubiläum zugetextet, zugezeichnet und lau aufgewärmt.
infobox: "Buddenbrooks - Thomas Mann und Lübeck", Dokumentation, Regie: André Schäfer, Buch: Hartmut Kasper, Kamera: Andy Lehmann, Produktion: Florianfilm (Arte/NDR, 26.5.25, 23.15-0.10 Uhr und bis 23.11.25 in der Arte-Mediathek)
Zuerst veröffentlicht 27.05.2025 11:48 Letzte Änderung: 27.05.2025 15:13
Schlagworte: Medien, Fernsehen, Kritik, Kritik.(Fernsehen), KArte, Dokumentation, Hupertz, NEU
zur Startseite von epd medien