Anhörung zum Digitale-Medien-Staatsvertrag läuft - epd medien
09.07.2025 09:15
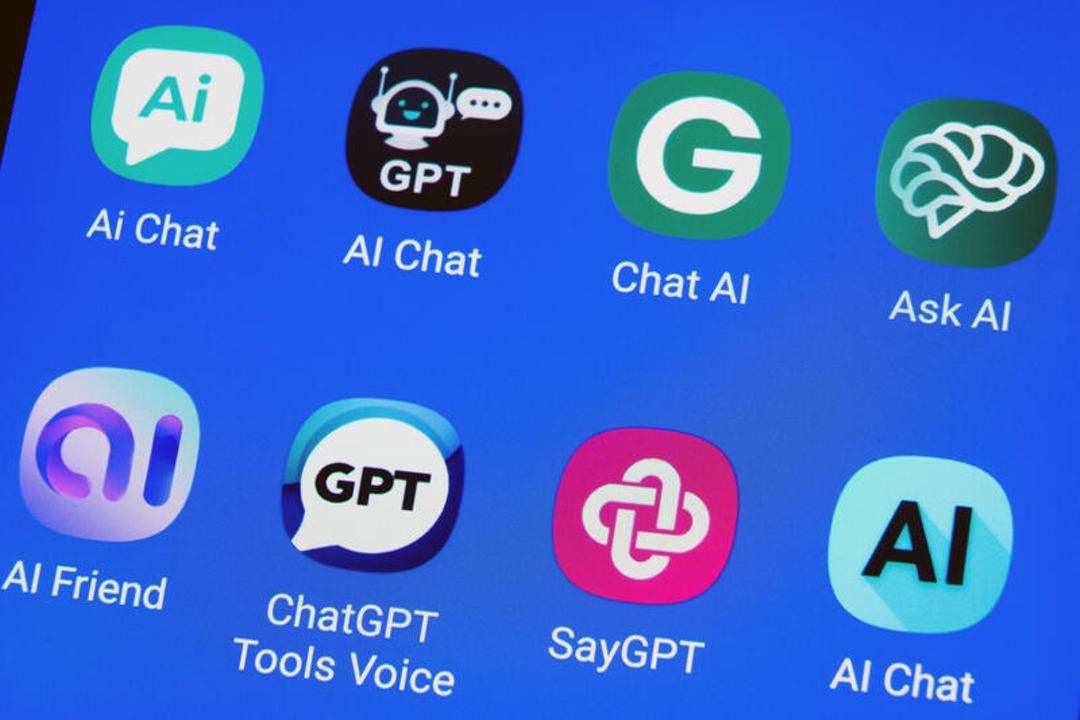
Mainz (epd). Die Rundfunkkommission der Bundesländer hat einen Diskussionsentwurf für den angekündigten Digitale-Medien-Staatsvertrag veröffentlicht. In mehreren Bereichen seien Anpassungen des bestehenden Medienstaatsvertrags an das Recht der Europäischen Union (EU) notwendig, erklärte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei, die den Vorsitz der Rundfunkkommission hat. Unter anderem gehe es um Vorgaben aus dem European Media Freedom Act (EMFA), der Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung sowie der Verordnung der EU zu Künstlicher Intelligenz (KI). Außerdem solle der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch die Landesmedienanstalten bei ihrer Aufsichtstätigkeit klarer gefasst werden, hieß es weiter. Die geplanten Regelungen können bis zum 31. Juli über eine öffentliche Anhörung online kommentiert werden.
Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei spricht beim Digitale-Medien-Staatsvertrag, der am 4. Juni von der Rundfunkkommission der Länder beschlossen wurde, von "einem Maßnahmenpaket zur Sicherung der kommunikativen Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft in Deutschland". Die Maßnahmen sollen in zwei Paketen umgesetzt werden. Im ersten Regelungspaket, für das die Anhörung nun läuft, steht die Anpassung an das europäische Recht im Zentrum. Beim zweiten soll es unter anderem um den Schutz digitaler Kommunikationsräume, die Refinanzierung von Medien und das Medienkonzentrationsrecht gehen. Wann hierzu ausgearbeitete Entwürfe vorliegen sollen, ist nicht bekannt.
Sicherer Einsatz von KI
Mit den Vorschlägen wollten die Länder "das europäische Recht und die technischen Entwicklungen in der nationalen Medienregulierung in Einklang bringen", erklärte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), der zugleich Vorsitzender der Rundfunkkommission ist. Ziel sei es auch, "schlagkräftiger zu werden beim Umgang mit den großen Plattformen und dem sicheren Einsatz von KI".
Mit den geplanten Vorschriften werden laut der Staatskanzlei vor allem Zuständigkeiten zur Medienaufsicht geregelt und an das EU-Recht angepasst. Weil beispielsweise die KI-Verordnung der EU eine nationale KI-Aufsicht vorschreibt, sind dazu ergänzende Regelungen notwendig. Diese Zuständigkeit sollen die Landesmedienanstalten erhalten. Vorgesehen ist, dass sich diese KI-Aufsicht auf Rundfunkveranstalter und Telemedienanbieter beschränkt, soweit es um den "Schutz der Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt" geht. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk betroffen, soll "die jeweils betroffene Rundfunkanstalt in das Verfahren" einbezogen werden.
Nationale Datenbanken zum Medieneigentum
Der EMFA der EU sieht vor, dass es in den Mitgliedstaaten "nationale Datenbanken zum Medieneigentum" geben muss. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK), ein Organ der Landesmedienanstalten unterhält bereits eine "Mediendatenbank", in der "die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse in Hörfunk, Fernsehen, Presse und im Onlinebereich" aufgelistet werden. Dass die KEK dieses Register führt, wollen die Bundesländer nun staatsvertraglich verankern. Dadurch soll laut Diskussionsentwurf das Verzeichnis als nationale Datenbank im Sinne des EMFA anerkannt werden.
Die Praxis, dass die Landesmedienanstalten bei ihrer Internet-Aufsicht bereits seit mehreren Jahren KI einsetzen, wollen die Bundesländer rechtssicher ausgestalten, insbesondere mit Blick auf datenschutzrechtliche Anforderungen. Alle 14 Medienanstalten verwenden seit 2022 das Tool KIVI, um so mögliche rechtswidrige Inhalte wie Hassrede, Gewaltdarstellungen und frei zugängliche Pornografie schneller zu finden. Ob tatsächlich Verstöße vorliegen, entscheidet nicht das Tool, sondern Juristen in den Medienanstalten.
Einsatz technischer Mittel
Entwickelt wurde KIVI von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Berliner Firma Condat. Mehr als 10.000 Webseiten können mit dem Tool laut der Medienanstalt täglich automatisiert durchsucht werden, darunter Plattformen wie Youtube, X, Telegram und Tiktok. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, verhindert bisher, dass KIVI die Seiten von Facebook und Instragram prüfen kann.
Die Bundesländer wollen nun festlegen, dass die Landesmedienanstalten technische Mittel einsetzen dürfen, "die Text, Bild, Audio und Bewegtbild in Rundfunk und Telemedien automatisiert auf potentielle Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrags abgleichen". Vorgesehen ist, dass nur öffentlich zugängliche personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden dürfen. Die erhobenen Daten müssen laut den Plänen außerdem durch Menschen überprüft werden. Die personenbezogenen Informationen dürfen laut Entwurf nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die Kontrollaufgaben nötig ist. Nur zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten soll es möglich sein, dass die Landesmedienanstalten die Daten auch an andere Behörden weiterleiten.
vnn
Zuerst veröffentlicht 09.07.2025 11:15
Schlagworte: Medien, Medienpolitik, Gesetze, Digitale Medien Staatsvertrag, Länder, vnn
zur Startseite von epd medien