Ein traumwandlerischer Menschenfresser - epd medien
30.09.2025 11:19
Zum Tod des Ur-Fernsehmenschen Georg Stefan Troller

epd Heinrich Heine befand einst: "Die Natur wollte wissen, wie sie aussieht, und sie erschuf Goethe." Heute, 200 Jahre später, könnte man in Anlehnung an ihn sagen: Das Fernsehen wollte wissen, wie es aussehen sollte, und es erschuf Georg Stefan Troller. Und man könnte hinzufügen: Die Menschen wollten wissen, wie sie sind. Deshalb vertrauten sie sich diesem ewigen Emigranten an.
Wer liest, hört und sieht, welches Echo der Tod Trollers - zwei Monate vor seinem 104. Geburtstag - hervorgerufen hat, der wird das alles so zusammenfassen: Es sind lauter Liebeserklärungen. Alle, die seine Fernseharbeiten kennen, seine Bücher gelesen, die zahlreichen Interviews mit ihm selbst gesehen haben, sie sagen unumwunden: Welcher Zauber ist zu erleben, wie unwiderstehlich ist der Bann, der von diesem Werk ausgeht. Ein Werk, das sehr umfangreich ist - mit geschätzt allein 2.000 Interviews in rund 170 Filmen, weiter mit zahlreichen Paris-Büchern und autobiographischer Innenschau. Ein Werk aber auch, das sich nie in konventionelle begriffliche Schubladen stecken lässt.
Unnachahmliche Intonation
Dokumentarfilmer, Reporter, Journalist, das ist jeweils viel zu eng. Troller, der/das ist etwas spezifisch Eigenes, zu spüren ab jedem ersten Moment - vor allem in einer unauflöslichen Verbindung von Bild, Text und Ton, getragen von einer sonoren Stimme mit einer unnachahmlichen Intonation. "Dichter des Films", so hat ihn sein Freund und Vertrauter Peter Stephan Jungk tituliert; und dabei im Gespräch mit Troller keinen Widerspruch geerntet, sondern nachdenkliches Einverständnis.
Film, das war, wie er mehrfach seinen Besuchern und Interviewern erklärt hat, seine Art, sich auszudrücken, seine Gedanken, Empfindungen, Eindrücke zu gestalten, ihnen eine ihm gemäße Form zu geben. Im Schreiben, so sah er es selbstkritisch, sei ihm dieses Ausdrucksvermögen nicht gegeben.
Sich im Film als Medium zurechtzufinden, das sei für ihn "überhaupt kein Problem gewesen", wehrt er in einem aufschlussreichen Interview mit dem Filmemacher Heinrich Breloer jeden Zweifel an seinem Fernseheinstieg Anfang der 60er Jahre ab; damals, als ihm der WDR von heute auf morgen das "Pariser Journal" als Reihe antrug (er selbst hatte damals nicht mal einen eigenen Fernseh-Apparat). Er sei schon immer ein begeisterter Fotograf gewesen, habe Theaterwissenschaft studiert, habe Kino gesehen und geliebt. Insofern: Alle künstlerischen Metiers und Techniken "flossen im Fernsehen zusammen", vom ersten Moment an habe er "ganz genau gewusst, was ich wollte", wie ein Film zu gestalten sei.
Der uneingeschränkte Autor
Ob sich diese Kenntnis und dieses Wissen einer inneren Intuition verdankten? Für ihn eine offene Frage. Was ihn von Anfang an begeisterte: In der Arbeit auch unter Zeitdruck (eine Woche im Schneideraum für eine 45-Minuten-Ausgabe des "Pariser Journals") direkt zu erleben, wie die Filme immer besser wurden, eine überzeugende Gestalt annahmen, ganz so, wie es seinen Vorstellungen entsprach. Nicht uninteressant dabei: Ganz zu Beginn der Reihe war er nur für den Text zuständig, die Bilder verantwortete ein anderer. Das änderte sich nach nur acht Folgen, er war der uneingeschränkte Autor, in jeder Hinsicht.
Wobei nie zu vergessen ist: mit Josef "Jossi" Kaufmann und Carl-Franz Hutterer hatte er Lieblings-Kameramänner, die (damals mit unhandlicher Technik) wie verlängerte eigene Augen seinen Intentionen folgten oder sie schon vorahnten, das Drehen jederzeit durch eigene Sensibilität bereichernd. Und immer wieder rühmte er die Fähigkeiten Elfi Kreiters, mit ihrem Schnitt seinen Filmen das unverwechselbare Gerüst einzuziehen. Wie kongenial diese Fähigkeiten zusammenspielten und zur einzigartigen Qualität beitrugen, belegen die Grimme-Auszeichnungen für alle: Fernsehen auf der Höhe seiner Möglichkeiten.
Immer ein Fremder
1987 standen Troller und Kreiter einmal gemeinsam auf der Marler Preisbühne, bei einem Gipfeltreffen der Fernsehgeschichte mit Namen wie Helmut Dietl, Hartmut Bitomski, Fritz Lehner, Wolfgang Menge und nicht zuletzt Claude Lanzmann, dessen Erinnerungsfilm "Shoah" damals tief erschütterte. Das überschwängliche Jurylob galt dem Dreiteiler "Wohin und zurück", realisiert durch Axel Corti. Dieser große Film im strengen Schwarz-Weiß über die Flucht eines Freddy Wolf vor Nazideutschland, Exil in Amerika und die Rückkehr in ein fremdes Nachkriegseuropa greift in den Grundzügen die Geschichte des Autors Troller auf. Der Titel des dritten Teils, "Welcome in Vienna", spiegelt die bittere Gewissheit einer tiefgreifenden Entfremdung und einer Erfahrung, die Troller bis zuletzt als prägend empfand: eigentlich immer ein Fremder zu sein, - in Paris, Amerika (den US-amerikanischen Pass führte er immer mit sich) oder in Deutschland.
In Paris übrigens wurde "Wohin und zurück" 2015 zu einem großen Publikumserfolg, bei höchstem Lob durch Claude Lanzmann (der sich mit Troller beim damaligen Grimme-Fest schnell verzog, als er das westfälische Buffet witterte). Sonst aber ließ sich die Attraktion, die erst das "Pariser Journal", dann die im ZDF aufgelegte Reihe "Personenbeschreibung" auf das deutsche Publikum ausübte, nicht exportieren. Ein wesentlicher Grund sicherlich: die einzigartig prägnante Sprache und die gestische Sprachmelodie des Autors, in einer schwingenden Mischung aus Lakonie und Poesie, mit zugleich klaren Benennungen und offenen Anspielungen.
Die eigene Wahrheit
Dies übrigens war genauestens ausgearbeitet; die beim Drehen eingesammelten Interviewaussagen transkribierte Troller per Hand, mit allen Betonungen, um im Kopf die Bild- und Wortkomposition zusammenzusetzen, die ihm vorschwebte. Sein Credo dabei: "Sieht man, was man gedreht hat, so sieht man die Realität anders." Wobei das, was gesehen wird, ohnehin "immer beeinflusst ist von dem, was wir denken, was wir fühlen".
In einem Interview mit der Fotografin Gisèle Freund (in der ZDF-Reihe "Zeugen des Jahrhunderts") umkreisen beide diesen Grundbefund des subjektiven Sehens, der ausschließt, dass es eine Form der objektiven Realität geben könne. Erst aus der Verbindung des Gesehenen (das in einem Bild immer zu einem Konzentrat wird) mit dem eigenen Empfinden und Denken entwickele sich über die eigene Wahrnehmung die jeweilige Wahrheit, da waren sich beide im Frage- und Antwortspiel einig. Bei diesem Einstunden-Format - das den Interviewer Troller regelmäßig im Gegenschnitt zeigt - wird übrigens überdeutlich, wie sehr die Beschränkung auf die reine Off-Stimme (sei es fragend, sei es beschreibend oder kommentierend) in den gebauten Filmen einen wesentlichen Faktor der Qualität ausmacht.
Vorstoß zum inneren Wesen
Anfangs, das stellte Troller im Rückblick fast schmunzelnd fest, konnte und wollte sich die WDR-Heimatredaktion mit seiner auf Subjektivität setzenden Methode nicht anfreunden, ganz im Gegenteil, sie versuchte, dem Autor konventionelle journalistische Fragen aufzudrücken. Er ließ sich jedoch nicht beirren, lockte vielmehr aus seinen Interviewpartnern über von manchen sicher als aggressiv empfundene Direktheit etwas über ihr Leben hervor, das sie sonst kaum preisgegeben hätten: für Troller immer ein Vorstoß zum Kern, zum inneren Wesen, nicht zuletzt zu den Verletzungen eines Menschen, gerade auch bei jenen, die - qua Prominenz - in der Öffentlichkeit ein festes, damit auch (be-)schützendes Bild von sich präsentieren wollen.
Eine solche vordringende Fragetechnik hatte er schon entwickelt, als er - eine Station seines Amerika-Exils - in Europa als US-Soldat Kriegsgefangene vernahm. Beteiligt war er in seiner 1943 begonnenen militärischen US-Mission auch an der Befreiung des KZ Dachau und der Einnahme Münchens. Das alles gehört zu der aus heutiger Sicht fast unglaublichen Geschichte, die den 16-Jährigen aus einem wohlhabenden Wiener Handelshaus wegen seiner jüdischen Herkunft aus Österreich fliehen ließ, zunächst in die Tschechoslowakei, dann weiter nach Frankreich.
Paris, die Abenteuerstadt
Dort wurde er interniert, doch gelang es ihm nach zwei Jahren, aus Marseille mit einem Visum in die USA zu emigrieren. Wo er - nach der GI-Zeit und der tiefen, geradezu abstoßenden Österreich-Enttäuschung - Anglistik und Theaterwissenschaft studierte. Dann ein Glücksfall: ein Fulbright-Stipendium führte ihn an die Sorbonne in Paris. Dieser Ortswechsel war bedeutend. Ein Ruf des RIAS - der für das Nachkriegs-Berlin bedeutende Rundfunk im Amerikanischen Sektor - war Auftakt einer journalistischen Karriere, die bald auch, ab 1952, mit weiteren Aufträgen aus den USA, Kanada und der Bundesrepublik, befeuert wurde - die Geburtsstunde des Paris-Korrespondenten Troller.
War es seine Traumstadt? Auf seiner ersten Fluchtstation in Frankreich hatte er Paris eher als Abenteuerterrain empfunden, das er mit seiner durchdringenden, nie zu stillenden Neugier erkunden und erforschen wollte, wie ein "Abenteurer in Zentralafrika", so beschrieb er es später einmal leicht ironisierend. Mithin: Er streifte während der deutschen Besatzung nächtens durch unbekannte Straßen und Gassen der Stadt, spähte Hinterhöfe aus, saugte diese Bilder des Unbekannten in sich auf - was in einem Fall fast zur Verhaftung (und damit wahrscheinlich zur Deportation nach Auschwitz) geführt hätte. Die Aussage einer Concierge rettete ihn. Paris blieb seine Abenteuerstadt. Und ließ ihn nicht los.
Das Nachkriegs-Paris durchstreifte er dann mit einer Kamera, einer Leica, die er als GI einem "Kraut"-Soldaten abgenommen hatte. Das erzählt er in der dritten Person ("Es gab einmal einen jungen Menschen in Paris ..."), die identisch ist mit dem amerikanischen, dann auch deutschen Radiokorrespondenten, der über diese Stadt berichten soll. Und der fragt: Welches Paris eigentlich? Für die Redaktionen sei klar gewesen: das Paris der weltbekannten Sehenswürdigkeiten, das Postkarten-Paris. Sein eigenes Paris, das er dann auf vielen Streifzügen entdeckt, auch erobert habe, habe sich "himmelweit davon unterschieden". So beschreibt er es im 2017 erschienenen Buch "Ein Traum von Paris" mit Texten und Fotografien aus den frühen 50er Jahren.
Wiener Vorbilder
Es ist ein oft tristes, ein armes und in vielen Vierteln, gerade im Osten, vom Abriss bedrohtes Paris. Im schmalen Band "Pariser Journal" (1966) waren noch ähnliche Fotos zu sehen, so aus den Kleine-Leute-Vierteln Belleville und Ménilmontant. Mitsamt den Beschreibungen ließen sich die Orte erkunden - heute sind sie nicht wiederzuerkennen.
Auch ein Reisebuch wie "Paris geheim", die Autobiographie "Selbstbeschreibung" oder die Essaysammlungen "Mit meiner Schreibmaschine" und "Unterwegs auf vielen Straßen" sind beste Belege, dass ihm seine früheren Wiener Vorbilder - changierend zwischen der Wiener Schule mit Hugo von Hofmannsthal und dem scharf-zynischen Urteil und Stil eines Karl Kraus - nicht aus dem Blick geraten sind. Unverkennbar ebenfalls, dass er dem Schreibideal eines Hemingway zuneigt, dass sich in seinen Filmen als innere Linie das amerikanische Modell der short stories erkennen lässt.
Meisterliche Porträts
Dies gilt gerade auch für die imposante Reihe "Personenbeschreibung". Jede einzelne der zwischen 1972 und 1993 entstandenen 70 Folgen ist ein jeweils meisterliches Porträt der vorgestellten Personen in einem breiten internationalen Spektrum, viel weiter vordringend als konventionelle journalistische Arbeiten. Nicht wenige der Filme, die immer auch ein genauer Spiegel der politisch-gesellschaftlichen Umstände sind, gelten geradezu als legendär, so zu Mohammad Ali, Peter Handke, Jakov Lind, Ron Kovic, Charles Bukowski. Zu verdanken ist das sicher auch der Freiheit, die Troller beim ZDF genoss.
Vielen Außenstehenden war es erstaunlich erschienen, dass der im ARD-Spektrum so erfolgreiche Autor, der die professionelle Kritik ebenso überzeugte wie ein großes Publikum, zum als konservativ eingestuften ZDF wechselte (verbunden auch mit dem Status eines Sonderkorrespondenten). Augenscheinlich verspürte er keine Einengung, im Gegenteil. Dass er hierarchische Fesselversuche abzuwehren verstand, hatte er schon in der Anfangszeit bei der ARD bewiesen.
Na, Professorchen?
Er war Er, ausgestattet mit dem Selbstbewusstsein eines außerordentlichen und weithin geschätzten Könners. Als 1980 das neue Pariser ZDF-Studio (Chef damals: Peter Scholl-Latour) in einem eleganten klassizistischen Bau in der Rue Goethe eröffnet wurde, war auch der 1977 ausgeschiedene Alt-Intendant Karl Holzamer erschienen. Troller, wie immer künstlerisch-leger gekleidet, ging auf ihn zu, um ihn auf seine Art zu begrüßen: "Na, Professorchen?!"
In Paris - das er später einmal in seinem "Geheim"-Buch als "Intensivierungsmaschine" beschrieb (zu der das Anarchische, Aufsässige, Ausschweifende,Verruchte gehörten) - wurde für ihn im hohen Alter das Alltagsleben natürlich immer beschwerlicher. Allein die Treppe, die nach dem Aufzugshalt im 6. Stock noch zur eine Etage höheren Wohnung zu überwinden war, hatte es in sich. Sein Lieblingsort, um sich mit Freunden zu treffen, das früher als Intellektuellentreffpunkt legendäre Café Flore, schien weit entfernt.
Schöpfer von Gesamtkunstwerken
Zum Glück wurde er seit Jahren, nach dem Tod seiner Frau, der Malerin Kirsten Lerche, von Anna Frandsen unterstützt: "Sein Lebenselixier", wie Peter Stephan Jungk sie beschrieb, mit immer neuen Momenten des Staunens, wenn sie seine Texte, etwa die "Welt"-Kolumne, in Sekundenschnelle per Laptop exportierte. Troller selbst besaß nie einen Computer, für seine "Schreibe" nutzte er nur eine altertümliche Maschine wie vom Flohmarkt.
War sie das Requisit eines Menschenfressers? Diese Charakterisierung kursierte wegen seiner unverblümten direkten Fragetechnik (das eindringliche Wissenwollen, die Fragen nach dem persönlichen Glück, nach dem Einverstandensein mit dem Leben gehörten fast immer dazu). Breloer hat dieses Bild weitergesponnen: Es sei ums Einverleiben gegangen, um den Austausch der anderen Erfahrungen mit den eigenen - eine Selbstvergewisserung durch Suchen und Sehen der besonderen Art.
War dies das Geheimnis des "Dichters des Films"? Sicher ist: Georg Stefan Troller war der traumwandlerische Schöpfer von Gesamtkunstwerken, die vor allem eines vermittelten: Bilder der condition humaine in allen ihren Facetten. Immer wieder also: Wohin und zurück ...
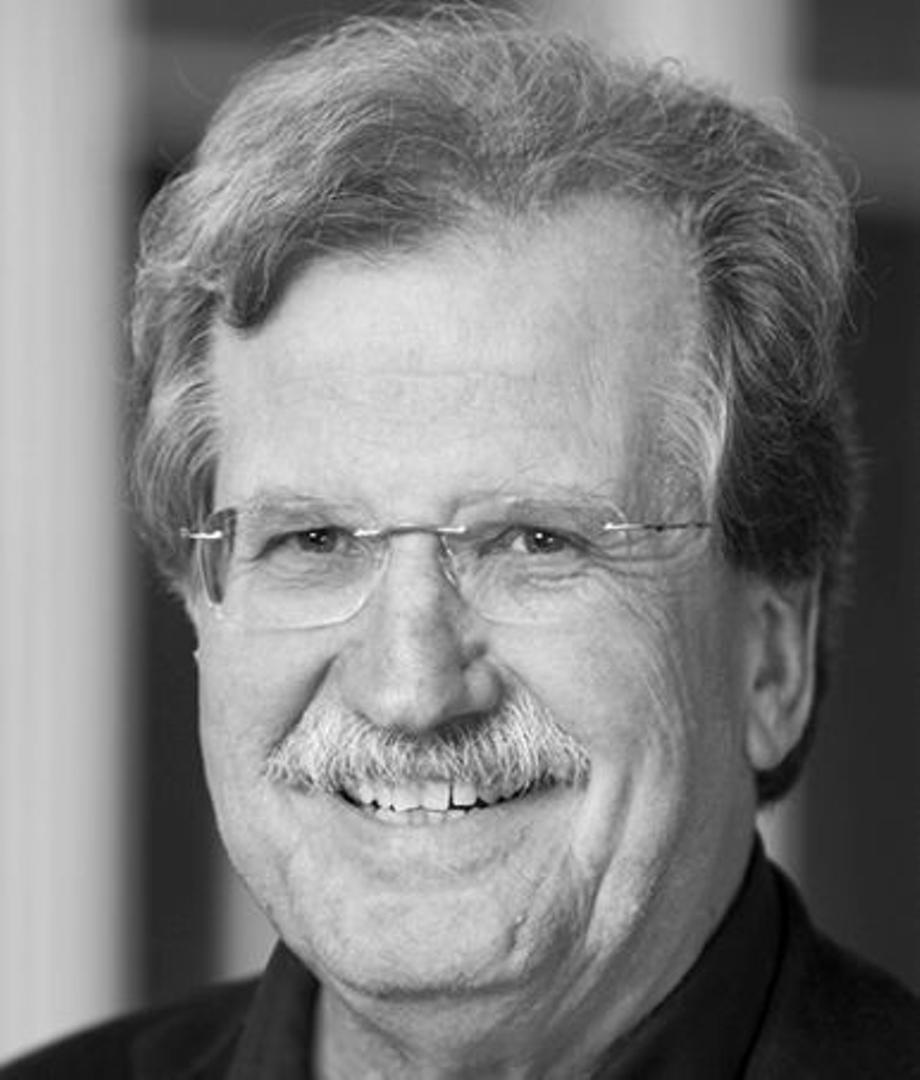 Copyright: Foto: privat
Darstellung: Autorenbox
Text: Uwe Kammann war von 1984 bis 2005 verantwortlicher Redakteur von epd medien und anschließend bis 2014 Direktor des Grimme-Instituts in Marl.
Copyright: Foto: privat
Darstellung: Autorenbox
Text: Uwe Kammann war von 1984 bis 2005 verantwortlicher Redakteur von epd medien und anschließend bis 2014 Direktor des Grimme-Instituts in Marl.
Zuerst veröffentlicht 30.09.2025 13:19 Letzte Änderung: 01.10.2025 11:28
Schlagworte: Medien, Fernsehen, Troller, Dokumentarfilm, Nachruf, Kammann, BER, NEU
zur Startseite von epd medien